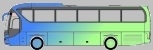Nochmal im Detail...
(ID 743543)
Nochmal im Detail...
Die ehemalige FS E.431.037 am 02.10.2010 im Technik Museum Speyer. Bis 1989 befand sich die Lok in dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.
Armin Schwarz 18.08.2021, 155 Aufrufe, 0 Kommentare
EXIF: FUJIFILM FinePix S5600 , Belichtungsdauer: 10/1600, Blende: 320/100, ISO100, Brennweite: 630/100
0 Kommentare, Alle Kommentare
Kommentar verfassen

Die ehemalige FS E.431.037 am 02.10.2010 im Technik Museum Speyer. Bis 1989 befand sich die Lok in dem Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.
Die italienische Baureihe E.431 war eine Elektrolokomotiv-Baureihe der staatlichen italienischen Eisenbahn Ferrovie dello Stato (FS). Sie wurde auf dem oberitalienischen Drehstromnetz besonders im Schnellzugdienst auf steigungsarmen geraden Strecken eingesetzt. Sie blieb bis 1976 im Betriebsdienst, und zwei Lokomotiven sind in Eisenbahnmuseen erhalten geblieben, die E.431.027 im Museo Ferroviario Piemontese bei Savigliano und diese hier in Speyer. Im Museum war sie als italienische Gebirgslok bezeichnet, was sie aber nicht ist.
Von diesen Lokomotiven wurde 37 Stück zwischen 1922 und 1925 bei TIBB (Tecnomasio Italiano Brown Boveri, heute Bombardier) und Ansaldo (heute Hitachi) gebaut. Die E.431 kann technisch als eine verlängerte Version der FS E.330 angesehen werden. Mit ihren vier Antriebsachsen konnte die E.431 ihre Leistung wesentlich besser auf die Schienen bringen. Vom Einsatzgebiet her war sie bevorzugt auf langen, flachen Strecken im Einsatz. Auf Bergstrecken war ihre Zugkraft im Bereich 50 km/h mangelhaft, wodurch sie nur mit Doppeltraktion verwendet werden konnte. Auch beschädigte sie auf kurvenreichen Strecken den Oberbau. Aber für den Schnellzugdienst im Piemont und Ligurien waren sie wie geschaffen. Die schweren Schnellzüge auf diesen Strecken, die eine Länge von bis zu 20 Wagen hatten, mussten von den Lokomotiven in Doppeltraktion mit gleichen oder fremden Lokomotiven (FS E.333, FS E.432) gefahren werden. Auch auf der steigungslosen Riviera-Strecke Genua – Ventimiglia waren die Lokomotiven in ihrem Element.
Zur Endzeit des oberitalienischen Drehstromnetzes waren nur noch Einsätze auf den kurvenreichen Strecken um Alessandria und S. Giuseppe di Cairo sowie Asti und Acqui Terme möglich, wodurch auf die Lokomotiven weitgehend verzichtet werden konnte. Dennoch sind einige Lokomotiven bis 1976 im Einsatz geblieben.
Mechanischer Teil:
Die Lokomotive war die erste Lokomotive des oberitalienischen Drehstromnetzes mit vier Antriebsachsen und zwei Antriebsmotoren. Die Laufachsen wurden mit der jeweils angrenzenden Treibachse zu einem Zara-Gestell verbunden. Trotzdem hatten die Lokomotiven einen schlechten Bogenlauf. Die Treibräder waren wie bei Dampflokomotiven ausgeführt, als Speichenräder mit Gegengewichten.
Auf dem kräftig ausgeführten Rahmen war ein von diesem abnehmbares Gehäuse montiert, welches im Inneren die beiden tief im Rahmen gelagerten Antriebsmotoren und das Schaltwerk verbarg. Außerdem war darinnen der Führerstand des Lokführers. An den Spitzen der Lokomotive waren zwei Vorbauten angesetzt, in ihnen befanden sich die Hilfsbaugruppen, wie Ventilatoren, Flüssigkeitsanlasser, Kompressoren und Druckluftbehälter für die pneumatische Bremse und der Hauptschalter.
Die beiden tief im Rahmen liegenden Antriebsmotoren wirkten über ein Dreieck-Gestänge auf die zweite Kuppelachse. Der Abstand zu den angrenzenden Kuppelachsen wurde sehr groß gewählt, der Abstand der letzten Kuppelachse zur vorhergehenden war entsprechend geringer. Bei Hauptausbesserungen mussten die Fahrmotoren der Lokomotiven nach unten anstatt nach oben abgenommen werden.
Elektrischer Teil:
Der elektrische Teil der Lokomotive wurde aus den beiden Antriebsmotoren gebildet, die umschaltbar als sechspolige bzw. achtpolige Drehstrommotoren ausgeführt waren. Ausgeführt waren die Lokomotiven mit vier Geschwindigkeitsstufen: 37,5 km/h, 50 km/h, 75 km/h und 100 km/h.
Der von der Fahrleitung übernommene Drehstrom wurde mit dem optimalen Leistungsfaktor den Fahrmotoren zum Antrieb übergeben. Wie bei der FS E.330 hatten die Rotoren der beiden Drehstrommotoren insgesamt sieben Schleifringe, vier auf dem einen Wellenende, drei auf dem anderen Wellenende. Dadurch wurden in Kombination zwischen der verschiedenen Polzahl und der Parallelschaltung bzw. der Reihenschaltung insgesamt vier Fahrstufen erreicht. Zwischen den vier Fahrstufen diente der Flüssigkeitsanlasser, der als sogenannter Beschleuniger zwischen den Dauerfahrstufen diente. Dieses Aggregat arbeitete als Flüssigkeitswiderstand, der eine gleichmäßige Beschleunigung beim Anfahren und beim Wechseln auf eine höhere Geschwindigkeitsstufe ermöglichte. Die Wirkungsweise des Flüssigkeitsanlassers und die Steuerung der Lokomotive geschah wie bei der E 330. Da sich die Sodalösung beim Beschleunigen erwärmte und zum Teil verdunstete, musste die Lokomotive beim Aufrüsten im Depot und von Zeit zu Zeit Wasser für die Widerstände nachfüllen. Dadurch konnten sie nur effektiv in den Geschwindigkeitsstufen arbeiten. Die Kühlflüssigkeit durchlief einen Rohrwärmetauscher und konnte beim Fahren in den Geschwindigkeitsstufen wieder abgekühlt werden.
Modifikationen:
Bei den Lokomotiven gab es einige Versuche, die vorhandenen Leistungsdefizite zu beseitigen, die aber insgesamt nicht erfolgreich waren. Der längliche Vorbau wurde einige Male abgekürzt, was das Aussehen der Lokomotiven etwas plumper wirken ließ. Selbstverständlich gab es Veränderungen in der pneumatischen Bremse und der elektrischen Beleuchtung. Hatten die Lokomotiven anfangs noch Gasbeleuchtung, wurde später eine elektrische Beleuchtung gewählt.
Technische Daten:
Gebaute Stückzahl: 37 (erhalten 2)
Spurweite: 1.435 mm (Normalspur)
Achsformel: 1'D1'
Länge: 14.610 mm
Höhe: 3.850 mm
Treibraddurchmesser: 1.630 mm
Achsabstand im Drehgestell: 3.020 mm
Dienstgewicht: 91 t
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h
Dauerleistung: 1.900 kW
Stromsysteme: 3,6 kV/16,7 Hz Drehstrom
Anzahl der Fahrmotoren: 2
Antrieb: Stangenantrieb mit Dreieck-Kuppelstange
Stromübertragung: direkte Stromübertragung von der Drehstrom - Fahrleitung zu Drehstrom – Fahrmotoren
Quelle: Wikipedia.
Armin Schwarz
Armin Schwarz
Deutschland / Museen und Ausstellungen / Technikmuseum Speyer, Italien / E-Loks (Locomotiva elettrica) / E.431
217 1200x858 Px, 18.08.2021

Die ehemalige Lok 22 der Süddeutsche Zucker AG, eine Diesel-Rangierlokomotive vom Typ DEMAG ML 55 am 02.10.2010 im Technik Museum Speyer noch als Spielobjekt. Nachdem sie einige Jahre als Spielobjekt diente, ist sie mittlerweile ein Ausstellungstück auf dem Freigelände.
Die normalspurige Lok wurde 1940 von DEMAG im Werk Wetter (Ruhr) für Südzucker (Werk Züttlingen-Jagst) gebaut (Fabriknummer unbekannt), mit der Schließung des Werkes 1971 ging sie an einen Schrotthandel, über diesen kam sie zum ATM - Auto & Technik Museum Sinsheim und 1996 zum Technik Museum Speyer (die Museen Sinsheim und Speyer gehören zusammen).
Wenig ist über den Diesellokbau bei der DEMAG im Werk Wetter (Ruhr) bekannt. Der Schwerpunkt lag bei Druckluftlokomotiven für den Bergbau. 1936 nahm die DEMAG den Dieselllokomotivbau auf. Die Anzahl der gebauten Maschinen bis zur Einstellung des Lokbaus 1957 ist unbekannt. Die Normalspurlokomotiven machen nur einen Bruchteil der Diesellokproduktion aus.
Die Deutsche Maschinenfabrik AG (DEMAG), entstand 1910 durch den Zusammenschluss der Märkischen Maschinenbau-Anstalt L. Stuckenholz AG, Wetter, der Duisburger Maschinenbau AG, und der Benrather Maschinenfabrik GmbH.
Der ganz überwiegende Teil der normalspurigen DEMAG-Lokomotiven war vom Typ ML 55.
TECHNISCHE DATEN der ML 55:
Spurweite: 1.435 mm
Achsfolge: B
Länge über Puffer: 5.800 mm
Achsstand: 2.500 mm
Raddurchmesser neu: 850 mm
Dienstgewicht: 15t
Motor: MWM 3 Zylinder / 4-Takt-Dieselmotor vom Typ GS 17 D
Leistung: 55 PS bei 1150 U/min
Höchstgeschwindigkeit: 14,5 km/h
Armin Schwarz
Armin Schwarz
Deutschland / Museen und Ausstellungen / Technikmuseum Speyer, Deutschland / Dieselloks / _Sonstige Normalspur Loks
230 1200x827 Px, 20.08.2021

Nein keine E-Lok, sondern eine Diesellok, der Stromabnehmer diente zur Steuerung von Signalen...
Die ehemalige Lok 2018 der Stadtwerke Frankfurt (Taunusbahnen) eine BMAG LDF 300 C12 (abgespeckte V 36) am 02.10.2010 im Technik Museum Speyer.
Die Lok wurde 1939 von der Berliner Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff (BMAG) unter Fabriknummer 10865 gebaut und an die Pulverfabrik Wolff & Co. KG aA in Walsrode als Lok 13 geliefert. Bereits 1943 ging sie an die Dortmund-Hörder Hüttenverein AG. Ende 1952 ging sie an die Schöma - Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH in Diepholz, dort erfolgten umfangreiche Umbauten u. a. neuer Motor vom Typ MWM TRHS 526 S und neue Druckluftanlage. Dann ging sie 1954 an die St.M.B. - Steinhuder Meer-Bahn GmbH, als Lok 271. Mitte 1962 ging sie an die Stadtwerke Frankfurt als Lok 2018 und erhielt dort, zur Steuerung von Signalen auf der Strecke der ehemaligen Frankfurter Lokalbahn, Stromabnehmer. Die Lokomotive wurde 1980 wegen eines Risses im Motorblock abgestellt und an die Historische Eisenbahn Frankfurt abgegeben. Zum Technik Museum Speyer kam die Lok im Jahr 2000.
Die Lok wird oft als WR 360 C 14 (V 36) Vorserienexemplar beschrieben, welches sie aber nicht ist. Die BMAG entwickelte aus der WR 360 C12 (Vorserien V36) eine 300 PS-Lokomotive für den industriellen Einsatz. Motorisiert wurde die Lok mit einem 8-Zylinder-Deutz-Motor des Typs A8M324. Bei nahezu gleichen Abmessungen wurden folgende Anpassungen gegenüber der WR 360 C12 vorgenommen:
• Übersetzung im mechanischen Teil des Getriebes geändert; Vmax 25 km/h; Zugkraft 12.000 kg
• Im Führerstand beidseitig vorhandene Handräder für einmännige Bedienung der Lok
• Verzicht auf Doppeloksteuerung (u. a. keine Übergangstüre im Führerstand)
Von dieser Type wurden vier Exemplare gebaut, die alle an die Pulverfabriken Wolff & Co. in Walsrode ausgeliefert wurden.
Die WR 360 C12 hatte gegenüber der V 36 (WR 360 C14) kein Stufengetriebe und war um 350 mm kürzerer.
Armin Schwarz
Armin Schwarz
Deutschland / Museen und Ausstellungen / Technikmuseum Speyer, Deutschland / Dieselloks / _Sonstige Normalspur Loks
348 900x1200 Px, 20.08.2021